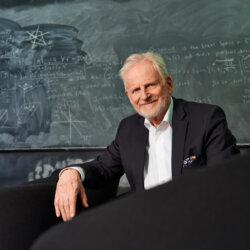Wie sehen Landwirtschaft, Wirtschaft und Tourismus in einer nachhaltigen Region aus? Sind sie fit, um die kommenden Veränderungen erfolgreich zu gestalten? (mehr …)
(Land)Wirtschaft und Tourismus
„AUFTRAGSVERGABEN ALS WIRKUNGSVOLLER HEBEL FÜR DIE GESTALTUNG UNSERER ZUKUNFT“
Kommentar von Club-Mitglied Dr. Robert Fink
zum PRESSE-Gespräch mit dem Vergaberechts-Spezialisten RA Mag. Martin Schiefer:
„AUFTRAGSVERGABEN ALS WIRKUNGSVOLLER HEBEL FÜR DIE GESTALTUNG UNSERER ZUKUNFT“ – veröffentlicht am 5.11.2023 in der Club-Homepage:
Zu Robert Fink:
- med.vet.
- Aufgewachsen in kleinbäuerlicher Umgebung (Eltern waren Nebenerwerbsbauern)
- 31 Jahre eigene tierärztliche Gemischtpraxis (Nutz- und Hobbytiere)
Parallel dazu:
- 14 Jahre Amtstierarzt beim Land NÖ und der BH Wien-Umgebung
- 12 Jahre Geschäftsführer des Tiergesundheitsdienstes Burgenland
- 8 Jahre Landesveterinärdirektor Burgenland
- Hobbyimker
„Ich teile die Meinung von Mag. Schiefer vollinhaltlich. Insbesondere, wenn man die erforderlichen Reparaturkosten umweltbedenklicher Produktionen und Verbringungen in die tatsächlichen Gesamtkosten miteinrechnet, ist eine gezielte Förderung von unbedenklicher Produktion mehr als gerechtfertigt und rechnet sich für den Fördergeber auch.
Als Beispiel nehme ich die landwirtschaftliche Produktion. Jeder Biobetrieb unterliegt genauen und kontrollierten Produktionsbedingungen, die vor allem den Einsatz von Pestiziden und Düngemittel reduzieren bzw. hintanhalten und damit den Eintrag bedenklicher, im natürlichen Boden nicht vorkommender Stoffe, zumindest sehr stark verringern. Dies führt dann fast automatisch zu einer größeren Diversität beim Anbau und daraus resultierend einer variableren Fruchtfolge, zu genauerer Beobachtung des Wachstums, zu einer Verbesserung des Bodenlebens usw. Damit ist der Weg zur Kreislaufwirtschaft fast vorgezeichnet. Reparaturkosten für die Öffentlichkeit entstehen bei dieser Bewirtschaftungsform nicht oder kaum.
Die Biolandwirtschaft ist wesentlich aufwändiger, fordert dem Bauern viel Wissen, Erfahrung, Kenntnis der biologischen Zusammenhänge und auch Risikofreude und Engagement ab. Schädlingsdruck kann nicht mit chemischen Mitteln begegnet werden und kann nur durch mehr Pflegearbeit soweit möglich verringert werden, mit dem Risiko einer geringeren Ernte. Unter diesen Produktionsvoraussetzungen kann man nicht erwarten, dass diese Produkte unter den üblichen marktwirtschaftlichen Mechanismen vermarktet werden können; da muss es mehr Sicherheit geben. Die Ernte des letzten Jahres musste beispielsweise zu wesentlich schlechteren Bedingungen verkauft werden, das ist in der Biolandwirtschaft finanziell kaum durchzustehen. Die „Überschussware“, die als Bioware wegen zu geringer Nachfrage nicht verkauft werden kann, muss zum Preis herkömmlich produzierter Ware vermarktet werden – das kann sich nicht ausgehen.
Bisher habe ich nur die pflanzliche Produktion mit den messbaren Größen des Produktionsaufwandes und der Erlöse angeführt. In der tierischen Produktion kommen noch zusätzliche Parameter wie Genetik und Tierhaltung mit Tierschutz entlang des gesamten Produktionsablaufes dazu – diese sind oft nicht mit Geld bewertbar.
Es ist daher unbedingt notwendig den bestehenden „Aktionsplan des Bundes zur nachhaltigen Beschaffung für den Einsatz von Bio-Lebensmitteln in öffentlichen Kantinen“ auszubauen und zumindest auf öffentliche und kommunale Großküchen auszuweiten. Die Biobauern hätten damit eine gewisse Abnahmesicherheit und damit verbunden sollte eine Mindestpreisgarantie sein. Damit schließt sich der Kreis zur „Auftragsvergabe als wirkungsvoller Hebel“. Bei der Abnahme von Bioprodukten sollte zusätzlich auch die regionale Produktion in die Preisgestaltung miteinbezogen werden.
Wo wäre der Benefit für die Gesellschaft?
- Die Biobewirtschaftung könnte ausgeweitet und damit die Folgeschäden durch die konventionelle Produktion hintangehalten werden.
- Es würde ein größerer Personenkreis mit Bioprodukten versorgt.
- Die Bioproduktion ist wesentlich weniger von Betriebsmitteln, die zum Teil aus dem Ausland bezogen werden (z.B. Ausgangsstoffe für die Pestiziderzeugung, Düngemittel,…), abhängig. Damit wäre in Krisenzeiten eine höhere und sicherere Eigenversorgung und mehr Unabhängigkeit von ausländischen Firmen gegeben.
- Durch die Vermeidung von Folgeschäden würden die Gesamtkosten für die Allgemeinheit nicht steigen.
- Wahrscheinlich wäre auch eine größere genetische Diversität.
Es wäre auch zu überlegen, ob man nicht eine Unterscheidung zwischen bäuerlicher und landwirtschaftlich-industrieller Produktion einführen sollte. Diese Unterscheidung ist bei Handwerk und Industrie eine Selbstverständlichkeit, obwohl im Grenzbereich eine klare Trennung oft nicht einfach ist.
Was charakterisiert eine industrielle Produktion? Das ist ein umfangreicher Maschineneinsatz, Arbeitsteilung, Spezialisierung, fachliche Qualifikation, Betriebsgröße usw. – eine eindeutige Definition gibt es nicht.
Wenn man diese paar Punkte genau betrachtet, dann hat der Biobauer wesentlich mehr händischen Einsatz, er produziert in Kreislaufwirtschaft oder zumindest in diese Richtung mit einer großen Produktpalette, fachliches Wissen vereint mit viel Erfahrung und genauer Beobachtung sind eine unabdingbare Voraussetzung. Unter diesen Voraussetzungen ist meist auch nur ein kleinerer Betrieb führbar – damit wären wir beim österreichischen bäuerlichen Familienbetrieb.
Derzeit kauft der meist kleinere (Bio-)Betrieb seine Betriebsmittel teurer als der Großbetrieb ein, produziert wesentlich teurer und muss dann mit seinen Produkten auf dem gleichen internationalen Markt vermarkten – ausgenommen Biobetriebe –, die aber die Bio-Überschussware auch auf diesen Markt bringen müssen. Die kleinen Betriebe geben nur das Image für die Vermarktung der industriell oder semiindustriell produzierenden Landwirtschaftsbetriebe her. Sie sorgen für die schönen Fotos mit alten Almhütten, blühenden abwechslungsreichen Feldern, Kühen im „Blumenmeer“ usw.
Ich höre schon den Aufschrei: „Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren“. Im jetzigen System sind die, die für die schönen Fotos sorgen, die Benachteiligten. Sie sind in den Interessensvertretungen nicht so stark vertreten, sie haben keine laute Stimme und sie geben still und leise ihre Höfe auf – auch da dienen sie dann noch als statistische Beweise, wie schlecht es allen Bauern geht.
Der Vorschlag der Trennung von kleinen (Bio)betrieben und industriell geführten Landwirtschaftsbetrieben zielt nicht dazu ab diese zu diskreditieren, sondern um für klare Verhältnisse zu sorgen. Es kann und soll auch die industriell geführten Betriebe geben, diese spielen aber in einer anderen Liga und das soll transparent erkennbar sein.
Der Fördergeber soll die Spielregeln neu und klar festlegen und dort verstärkt fördern, wo eine nachhaltige Produktion möglichst ohne oder mit nur geringen Folgekosten gesichert ist. Dies gilt nicht nur für die landwirtschaftliche Produktion, die Berücksichtigung der Folgekosten sollte in allen Wirtschafts-, Produktions- und Lebensbereichen eine Selbstverständlichkeit sein.
Dr. Robert Fink, im Jänner 2024
Mit diesem Kommentar eröffnen wir die Diskussion – sowohl zum PRESSE-Gespräch als auch zu den Aussagen von Robert Fink. Schreibt uns an JA@clubofome-carnuntum.at und wir veröffentlichen auch eure Stellungnahmen – in der Club-Homepage und zusätzlich in Sozialen Medien.
Ein guter Vorsatz für 2024: Breite Bretter bohren
Gastkommentar von DR. FRED LUKS im DER STANDARD:
Ein guter Vorsatz für 2024: Breite Bretter bohren
Fantasie ist gut. Doch in der Debatte über Nachhaltigkeit haben Lösungen, die soziologisch naiv, ökonomisch abwegig, psychologisch unplausibel oder politisch gefährlich sind, nichts zu suchen. Realismus ist angesagt.
Weltfremde Ignoranz kann man sich in einem Superwahljahr nicht erlauben, schreibt Ökonom Fred Luks in seinem Gastkommentar.
Beginnen wir mit zwei realen Begebenheiten, die sich nicht in der fernen Vergangenheit zugetragen haben, sondern tatsächlich im Herbst 2023. Erstens: Der Chefvolkswirt einer Bank erörtert Szenarien zur Wirtschaftsentwicklung im kommenden Jahr. Klimawandel, Migration und der Ausstieg aus fossilen Energieträgern kommen dabei nicht vor. Was man für einen bösen Scherz halten könnte, ist bitterer Ernst: Es gibt Leute, die die Wirtschaft verstehen wollen, ohne über das Wirtschaftliche hinauszudenken.
Dabei hat Friedrich August von Hayek schon vor Jahrzehnten darauf hingewiesen, dass jemand, der nur Ökonom ist, kein guter Ökonom sein kann. Man könnte ergänzen: Wer nur Ökologin ist, kann keine gute Ökologin sein. Das führt uns zur zweiten Begebenheit: Auf einem hochkarätigen Event der Nachhaltigkeitscommunity wird das Publikum im Modus der Druckbetankung mit ökologischen Horrorszenarien konfrontiert, ohne dass auch nur ein Satz zum gesellschaftlichen Zustand der Welt fällt.
„Wer nur Ökologin ist, kann keine gute Ökologin sein.“
Das Problem ist nicht, dass die Sorge vor ökologischen Desastern unbegründet ist. Nein, es liegt darin, dass man Warnungen vorm Untergang und Aufforderungen zur Umkehr seit Jahrzehnten hört und dass zwar nicht nichts passiert ist, aber eben doch deutlich zu wenig. Und das könnte daran liegen, dass die Ökos noch immer zu viel über die Umwelt und zu wenig über die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen einer erfolgreichen Transformation nachdenken.
Aber Moment mal – ist das nicht viel zu simpel beschrieben? Krankt diese Beobachtung nicht selbst an offensichtlicher Unterkomplexität? Nun, natürlich gibt es viele interdisziplinär denkende Umweltbewegte, und in der Wirtschaft sitzen immer öfter Leute an den Schalthebeln, die um die Relevanz sozial-ökologischer Themen für ökonomischen Erfolg wissen. Aber das ändert leider nichts am Gesamtbefund.
Grüner Populismus
Denn: Bei allen unbestreitbaren Fortschritten der letzten Jahrzehnte strotzt der Diskurs über Nachhaltigkeit nur so von „Lösungen“, die soziologisch naiv, ökonomisch abwegig, psychologisch unplausibel oder politisch gefährlich sind und nicht selten all das gleichzeitig. Zugespitzt: Es gibt einen Ökologie-Populismus, der von ebenso fantasievollen wie praktisch unergiebigen Verbesserungsvorschlägen geprägt ist. Ihm steht ein Ökonomie-Populismus gegenüber, der von einem reichlich fantasielosen Glauben an Effizienz, Expansion und elaborierte Technik dominiert wird.
Fantasie ist ein unverzichtbarer Treibstoff für eine gesellschaftliche Transformation zur Nachhaltigkeit. Aber sie sollte halt nicht hermetisch von jeder gesellschaftspolitischen und ökonomischen Realität abgeschottet sein. Der Vorwurf, die Politik kümmere sich zu wenig um naturwissenschaftliche Erkenntnisse, ist richtig – aber er schmeckt reichlich schal, wenn Vorschläge zur Weltverbesserung von sozial-, wirtschafts- und geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen völlig unbeleckt sind.
Politik mit Hausverstand
Wenn allen Ernstes postuliert wird, „wir“ hätten es in der Hand und „wir“ könnten alles besser machen, wenn „wir“ nur wollten, dann muss man fragen, wer dieses Wir sein soll – und wird auf die ernüchternde Erkenntnis stoßen, dass dieses vermeintlich nachhaltigkeitsaffine Kollektiv bestenfalls eine Fata Morgana ist und schlimmstenfalls ein Selbstbetrug von Leuten, die es besser wissen müssten. Wer an Nachhaltigkeit interessiert ist, kann sich nicht mit gut gemeinten Ideen zufriedengeben, sondern sollte für gut gemachte Handlungen und Unterlassungen streiten.
Gerade wenn man an einer nachhaltigen Entwicklung interessiert ist, muss man die Unerfreulichkeiten zur Kenntnis nehmen, die den eigenen Hoffnungen entgegenstehen. Wo das politische Spitzenpersonal wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert und dies dann auch noch als eine „Politik des Hausverstands“ verkaufen will, stehen die Zeichen schlecht für eine Verbesserung der Lage. Auch darf man sich klarmachen, dass ein großer Teil der österreichischen Bevölkerung sich einen radikalen Klimawandelleugner als Kanzler wünscht und dass die EU in keinem Land so negativ gesehen wird wie hierzulande.
Beitrag zur Weltverbesserung
Wer all dies nicht zur Kenntnis nehmen will, wird zur Transformation gesellschaftlicher Verhältnisse herzlich wenig beitragen. Und dann ist man bei Max Webers vielzitierter Aussage, Politik bedeute „ein starkes langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich“. Das mag altmodisch klingen, ist aber an Aktualität kaum zu überbieten.
Vielleicht ist der Jahreswechsel ein guter Anlass, das Bretterbohren als unverzichtbaren Beitrag zur Weltverbesserung anzuerkennen und bei der Gelegenheit die Breite der Bretter vor dem eigenen Kopf zu reflektieren. Zumal in einem Jahr, in dem das EU-Parlament, der Nationalrat, drei deutsche Landtage in AfD-Hochburgen und der US-amerikanische Präsident gewählt werden, sollte man sich weltfremde Ignoranz nicht erlauben – sondern die gesellschaftlichen Bedingungen ernst nehmen, unter denen Zukunftsfähigkeit, Wohlstand und Freiheit erreicht und gesichert werden sollen.
Fred Luks, im Dezember 2023
https://www.derstandard.at/story/3000000201231/ein-guter-vorsatz-f252r-2024-breite-bretter-bohren
Dr. Fred Luks ist Ökonom, Nachhaltigkeitsforscher und Publizist. Er war – im Auftrag des Energieparks Bruck/Leitha und im Rahmen des LEADER-Projekts „Take the Chance – Be the Change“ – wissenschaftlicher Begleiter bei der Erarbeitung des Manifests „JA!“: https://www.clubofrome-carnuntum.at/ja/. Am 3. April begrüßen wir ihn zu unserem 3. Club-Abend 2024. Thema: Sein aktuelles Buch „Ökonomie der Großzügigkeit“: https://www.clubofrome-carnuntum.at/event/oekonomie-der-grosszuegigkeit-das-nachhaltige-fuellhorn/ – Hier sein Artikel dazu in DIE FURCHE: https://www.clubofrome-carnuntum.at/2023/oekonomie-der-grosszuegigkeit-das-nachhaltige-fuellhorn/.
Bild: Foto Getty Images Leo Patrizi
Ökonomie der Großzügigkeit: Das nachhaltige Füllhorn
Dr. Fred Luks in „Die Furche“:
Ökonomie der Großzügigkeit: Das nachhaltige Füllhorn 
Unsere Zeit ist von Unsicherheit und Orientierungslosigkeit geprägt. Es wird immer klarer, dass die Klimaerwärmung desaströse Folgen hat, wenn nicht entschlossen gegengesteuert wird. Die Digitalisierung der Wirtschaft und des Lebens schreitet scheinbar unaufhaltsam voran – mit nicht nur erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Folgen, sondern auch mit ökologischen Konsequenzen: Digitale Technologien sind eben nicht „virtuell“, sondern fußen auf einem massiven Verbrauch von Material und Energie. Und mit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist deutlich geworden, dass das Undenkbare möglich ist: ein Krieg mitten in Europa.
Diese Situation, die oft als „Polykrise“ bezeichnet wird, stellt das westliche Wohlstandsmodell grundsätzlich in Frage. Ein Wohlstand, der auf billiger fossiler Energie und der massiven Übernutzung der Natur basiert, ist nicht haltbar. Unsere Wirtschafts- und Lebensweise kommt an ihr Ende. Wer die herrschende Nicht-Nachhaltigkeit überwinden und eine zukunftsfähige Gesellschaft will, kommt daher nicht daran vorbei, die mit dieser Lebensweise verbundenen Normalitäten zu hinterfragen. Das gilt zum Beispiel für die Umweltpolitik, den Umgang mit Tieren oder für etablierte wirtschaftliche Leitbilder wie Wachstum und Effizienz.
Auftragsvergaben als wirkungsvoller Hebel für die Gestaltung unserer Zukunft
Im Gespräch mit dem Vergaberechts-Spezialisten RA Mag. Martin Schiefer:
Auftragsvergaben als wirkungsvoller Hebel für die Gestaltung unserer Zukunft
ESG-Aspekte rücken bei Auftragsvergaben stärker in den Mittelpunkt, sagt Vergaberechts-Spezialist Martin Schiefer. Er fordert mehr Fokus auf Regionalität bei öffentlichen Aufträgen.
Die Presse: Viele Vergabeprozesse laufen seit Jahrzehnten nach demselben Schema ab. Sie fordern hingegen von Auftraggeberinnen und Auftraggebern, umzudenken und dabei vor allem die Faktoren Regionalität und ESG-Kriterien stärker bei öffentlichen Auftragsvergaben zu berücksichtigen. Warum eigentlich?
Martin Schiefer: Öffentliche Auftraggeberinnen und Auftraggeber haben einen der stärksten Hebel für die Gestaltung unserer Zukunft in der Hand: Geld. Rund 61 Milliarden Euro werden jährlich über öffentliche Ausschreibungen vergeben. Ein Betrag, der – wenn er als Investition verstanden wird – viel für uns und vor allem für die nachkommenden Generationen bewirken kann. Damit sich diese Hebelwirkung entfalten kann, müssen Faktoren wie Regionalität und das Einhalten von ESG-Kriterien in Ausschreibungen mehr Gewicht bekommen. Wir sind überzeugt: Die ausschließliche Orientierung am Billigstbieterprinzip führt Österreich als Wirtschaftsstandort und uns als Gesellschaft in eine Sackgasse.
Welche Hebel können Auftraggeberinnen und Auftraggeber durch eine Ausschreibung in Bewegung setzen, die ESG-Kriterien stärker gewichtet?
Neben der Geldfrage müssen sich Auftraggeberinnen und Auftraggeber auch die Frage stellen, welche Unternehmen stärker belohnt werden sollen. Es gibt in Sachen Klimaschutz zwar auch Regulatorien und Vorgaben zu berücksichtigen, doch gerade jene Unternehmen, die sich in Sachen ökologisches und soziales Engagement besonders hervortun, sollten von der öffentlichen Hand stärker bevorzugt werden.
Unser Appell lautet daher: Warten wir nicht auf neue Regulatorien, sondern berücksichtigen wir in Vergabeprozessen schon jetzt jene Unternehmen, die entsprechende Maßnahmen setzen. Denn bei den ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance, Anm.), von denen alle reden, geht es nicht nur um Environment, also die Umwelt, sondern auch um das „S“, also soziale Faktoren wie den Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und gerade diese können durch entsprechende Kriterien gefördert werden.
Wie kann das konkret aussehen?
Die öffentliche Auftraggeberin oder der öffentliche Auftraggeber darf sich etwas wünschen. Auch Transformation bei seinen Auftragnehmerinnen und Auftragnehmern. Das kann so weit gehen, dass gewisse Geschäftsmodelle auch ausgeschlossen werden. Unternehmen, die den Auftrag haben wollen, müssen sich diesem Regime, wenn wir es so nennen wollen, unterwerfen. Bei Vergaben darf das, was in der Gesellschaft passiert, nicht ausgeblendet werden. Im Gegenteil: Wir müssen Unternehmen, die ESG-Kriterien ernsthaft berücksichtigen, viel stärker belohnen. Wer nachhaltig und sozial wirtschaftet, hat häufig mehr Aufwand und höhere Kosten. Durch die Berücksichtigung von ESG-Kriterien wie eben Regionalität würden wir für verantwortungsvolle Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil schaffen. Und damit auch andere ermutigen, mehr in diese Richtung zu forschen, zu investieren und innovativer zu werden.
Haben Sie so etwas bei einer Ausschreibung in jüngster Zeit bereits angewendet?
Ja, mit Erfolg: Bei der Vergabe eines Auftrags für Pflegedienstleistungen war das Ermöglichen von freiwilliger Mitarbeit im Ort ein Vergabekriterium. Aber solche Ansätze finden sich noch viel zu selten. Das spüren wir selbst auch: Als Kanzlei achten wir sehr stark auf Gleichbehandlung, sind divers und bewusst familienfreundlich durch flexible Arbeitszeiten, sind regional vertreten. Das ist nicht immer einfach und verursacht auch Kosten. Diese Anstrengungen werden aber bisher leider nur selten belohnt.
Macht die Abkehr vom Billigstbieterprinzip Projekte nicht teurer?
Wir leben nicht auf einer Insel, das ist daher nicht die Frage, die wir uns stellen sollten. Es kann nicht sein, dass jemand sagt, dass es ihr oder ihm nur um den Preis gehe, während die breite Wirtschaft bereits in Richtung Nachhaltigkeit unterwegs ist und sich entsprechend positioniert. Wir müssen uns als Gesellschaft fragen: Wollen wir im Jahr 2023 wirklich Unternehmen fördern, die mit alten, stinkenden Diesel-Lkw durch die Welt fahren und ihren Gewinn auch damit erzielen, dass sie ihre Mitarbeitenden nicht regulär anstellen, sondern in prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigen?
Bund, Länder und Gemeinden geben jährlich rund 61 Milliarden Euro für öffentliche Aufträge aus – mit Fokus auf Bau und Infrastruktur. Es sind gewaltige Summen Steuergeld im Einsatz, die eindeutig im Sinne einer lebenswerten Zukunft ausgegeben werden sollten. Gerade die Baubranche verursacht mit über 30 Prozent den höchsten Anteil der öffentlichen Emissionen in Österreich. Öffentliche Auftraggeberinnen und Auftraggeber können mit ihren Aufträgen daher auch erwünschte ökologische Entwicklungen vorantreiben.
Bei der Vergabe von Bauaufträgen heißt das: Weg vom Billigstbieter- hin zum Bestbieterprinzip. Auch ESG-Kriterien sind bewertbar, sie müssen nur in der Ausschreibung klar definiert werden, dann ist das Verfahren absolut transparent. Wir werden uns auch mit Klimaanpassung beschäftigen und diese auch bei Vergaben berücksichtigen müssen: Von den Fluten weggeschwemmte Häuser sind teurer, als sich von Anfang an vom Billigstbieterprinzip zu lösen, und einen entsprechenden Leitfaden zu erstellen.
Ist das in den Köpfen der öffentlichen Auftraggeberinnen und Auftraggeber bereits angekommen?
Auftraggeberinnen und Auftraggeber erkennen zunehmend, dass sie mit Auftragsvergaben über einen sehr wirkungsvollen Hebel verfügen, um zukunftsorientiertes, sozial gerechtes und verantwortungsvolles Wirtschaften gegenüber Umwelt und Gesellschaft zu fördern. Schwerpunkte wie Regionalität, kurze Lieferketten und nachhaltiges Wirtschaften in Ausschreibungen können wesentlich zum Klimaschutz beitragen.
Das macht Aufträge komplexer – komplexer bedeutet aber nicht automatisch teurer, wenn die Planung richtig gemacht wird. Was die Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer angeht, so müssen diese sich darauf einstellen, dass Fragen, wie sie ihren Gewinn erzielen und was sie für die Gesellschaft leisten, in Zukunft stärker in den Mittelpunkt rücken.
Sehen Sie ein Umdenken in der Gesellschaft? Klimaschutzmaßnahmen scheinen politisch immer schwerer umsetzbar zu werden, wenn sie mehr Anstrengung brauchen – Stichwort Erneuerbare-Wärme-Gesetz oder CO2-Steuer.
Es geht nicht nur um die Politik: Diese kann nur die Rahmenbedingungen vorgeben. Wir brauchen dringend einen gesellschaftlichen Konsens, um diese Innovation voranzutreiben.
Wir haben in Österreich keine Rohstoffe unter der Erde, die unsere wirtschaftliche Zukunft sichern, sondern nur unsere Köpfe, und diese müssen wir anstrengen, um den Wandel voranzutreiben.
DIE PRESSE, 30. 10. 2023
https://www.diepresse.com/17779517/auftragsvergaben-als-wirkungsvoller-hebel
ChatGPT ist erst der Anfang vom Einsatz der KI
„ChatGPT ist erst der Anfang vom Einsatz der KI“
Digitalexperte Sascha Lobo verrät, worauf wir uns in der Zukunft gefasst machen können und warum wir mehr vertrauen sollten.
„Kärntner Wirtschaft“: Was werden die größten digitalen Trends sein, die Wirtschaft und Gesellschaft in den nächsten Jahren beeinflussen?
Sascha Lobo: Erstens die generative Künstliche Intelligenz (KI), wie sie mit ChatGPT bekannt geworden ist. Also KI, die Daten nicht nur klassifiziert, sondern auch generiert. Dabei war ChatGPT aber erst der Weckruf. Und zweitens eine neue Art der Kommunikation aufgrund dieser neuen Technologien. Chatbots kennt man ja bereits aus dem Service, hier sprechen wir aber von einer völlig neuen Qualität. Es wird nicht mehr nachvollziehbar sein, ob man mit einem Menschen oder einer Maschine kommuniziert.
Welche Rolle spielt KI künftig in den Unternehmen?
Sie wird sicherlich vieles auf den Kopf stellen. Ein Bereich, der wohl die meisten Betriebe betreffen wird, ist zum Beispiel der Microsoft-Copilot. Hier werden Microsoft-Anwendungen mit KI verknüpft. Dadurch wird es möglich, dem System etwa den Befehl zu geben, aus einer Excel-Liste eine Präsentation mit zehn Folien zu erstellen und alles von meinem Arbeitskollegen Tom einzubauen, was er mir diese Woche in Outlook geschickt hat. Das wird unsere Arbeitsprozesse nachhaltig verändern, auch wenn der Copilot in Europa noch nicht erlaubt ist.
Welche Anwendung sollte man noch im Auge behalten?
AutoGPT – eine Weiterentwicklung von ChatGPT, die mit dem Internet verbunden ist. Es arbeitet Aufgaben automatisiert ab, verteilt Subaufgaben an andere KI-Programme und erreicht somit eine neue Stufe autonomer KI. Ich könnte zum Beispiel die Suchanfrage nach Schuhen einer bestimmten Marke in einer bestimmten Farbe und Größe zu einem Wunschpreis stellen und würde dann in Echtzeit ein Ergebnis bekommen. Das ist ein radikaler Wandel, bei dem wir auch Unternehmensprozesse neu denken müssen.
Wie können kleine Betriebe von der Digitalisierung profitieren?
Sie profitieren vom Manufakturcharakter, der sich vor allem im Sinne des Marketings in den sozialen Medien sehr gut darstellen lässt. Ein Tischler, der seine Leidenschaft für das Handwerk inszenieren möchte, kann dazu Instagram nutzen. Bei den Inhalten kommt es darauf an, dass sie effektiv, effizient, innovativ oder einfach humorvoll sind. Auch der Verkauf der Produkte kann ja unabhängig von der Betriebsgröße in einem Online-Shop erfolgen und viele Backoffice-Aufgaben laufen ohnehin schon automatisiert.
Wie wichtig sind soziale Medien generell in der Unternehmenskommunikation?
Das hängt natürlich von der Branche ab und reicht von null bis 100. Das Wichtigste ist aber, immer ein Ziel für seine Botschaft zu haben, und das muss nicht immer der Kauf sein. Oft geht es darum, Multiplikatoren zu gewinnen oder einfach nur zu unterhalten. TikTok hat den besten Empfehlungsalgorithmus überhaupt und wird daher auch von den über 30-Jährigen als Wissenskanal genutzt. Rechtsanwälte erklären etwa auf unterhaltsame Art und Weise komplexe Sachverhalte – das funktioniert.
Elon Musk lässt Chips ins menschliche Hirn implantieren, Mark Zuckerberg träumt von einem Metaversum – Wie sieht die digitale Zukunft aus?
Wir machen auf diesen Gebieten aktuell Quantensprünge nach vorne, eine Prognose ist daher schwierig. Ich denke, beides ist möglich und wird wohl verschmelzen, auch wenn ich mir keinen Chip einsetzen lassen würde – das liegt aber an Elon Musk und nicht an dem Chip.
Ist Österreich für die digitale Transformation gerüstet?
In Österreich ist es ähnlich wie in Deutschland, wir sind führend beim unausgeschöpften Potenzial. Die Skepsis vor diesen Entwicklungen ist enorm groß und das hemmt den Fortschritt. Das kann man sich nur leisten, solange es noch eine tragfähige Wirtschaft gibt. Der Druck wird aber global steigen und es ist besser den Wandel hin zur KI-Transformation aus eigener Kraft zu gestalten, anstatt geschwächt Trends zu folgen.
Sascha Lobo (48) ist Journalist, Blogger, Digitalisierungs- und KI-Experte. Seit Jänner 2011 schreibt er die wöchentliche Kolumne „Mensch-Maschine“ auf Spiegel Online. In seinem neuen Buch „Die große Vertrauenskrise“ analysiert er den Vertrauensverlust in Wissenschaft, Information, Politik und Demokratie. Er lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Berlin.
Von Claudia Blasi, Redakteurin „Kärntner Wirtschaft“, 2. 11. 2023
https://www.wko.at/ktn/news/-chatgpt-ist-erst-der-anfang-vom-einsatz-der-ki-
Wie wir die Ressourcenwende schaffen
Seit kurzem ist der Club of Rome Carnuntum Mitglied im Ressourcenforum Austria. Es beschäftigt sich mit der Ressourcenwende in der Produzierenden Wirtschaft, in der Land- und Forstwirtschaft und in Gemeinden.
Nun erschien der Tagungsband des 5. Nationalen Ressourcenforums „VISION 2050“. Hier Auszüge aus der Eröffnungsrede von Präsident Rudolf Zrost.
Wie wir die Ressourcenwende schaffen
Es ist uns allen bewusst, dass wir eine andere Art von Mobilität benötigen und dass erneuerbare Energien nicht nur notwendig sind, sondern geradezu unumgänglich. Dass diese Veränderungen nicht weit genug gehen, wenn wir unsere globale Gesellschaft in eine Ära innerhalb der planetaren ökologischen Grenzen führen wollen, wird allerdings oft übersehen.
Keine Klimarettung ohne Ressourcenwende
Denn neben der verbrauchten Energie für Licht, Wärme und Bewegung ist es vor allem der Ressourcenverbrauch für unsere Produkte und Infrastrukturen der zu massiven Umweltproblemen führt. Berechnungen des Weltressourcenrates zeigen, dass etwa die Hälfte der globalen Treibhausgasemissionen sowie 90 Prozent des Biodiversitätsverlusts und der Wasserknappheit auf die Gewinnung und Verarbeitung von Ressourcen zurückzuführen sind. Somit ist klar, dass eine effektive Ressourcenwende von großer Bedeutung ist, um den Klimawandel und andere Umweltprobleme zu bekämpfen. Die ökologische Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft ist deshalb unser gemeinsames Ziel.
Transformation

Dies geht nur, wenn wir auf Ressourceneffizienz (also „weniger ist mehr“) durch Kreislaufwirtschaft (also „Materialkreisläufe schließen“) und Bioökonomie (also “Ersatz von fossilen Rohstoffen durch nachwachsende Rohstoffe”) setzen. Alle drei Konzepte und ihre Maßnahmen sind miteinander verbunden und voneinander abhängig! Gemeinsam haben Sie eines: Die Achtsamkeit gegenüber dem Material, das uns die Natur zur Verfügung stellt, um unsere Zivilisation in Schwung zu halten. Europa beginnt den grünen Umbau mit vielen einzelnen Schritten. Manc
he sind lästig, manche werden sich in der Rückschau auch als falsch herausstellen. Aber die Richtung stimmt.
50 Jahre nach „limits to growth”
Mehr als 50 Jahre nach dem Club-of-Rome Bericht „limits to growth” suchen wir immer noch nach einer Formel, wie wir Wohlstand, Wertschöpfung und eine intakte Umwelt in Einklang bringen können. Das zeigt uns die Notwendigkeit, dass wir den Mut haben müssen, alte Denkmuster zu durchbrechen und uns auf innovative Lösungen zu konzentrieren. Wir brauchen echte Veränderungen, um die Zerstörung unserer Umwelt zu beenden.
Bildnachweis: Neumayr/RFA
Wie Unternehmen ihren CO2-Footprint ermitteln

Wie Unternehmen ihren CO2-Footprint ermitteln
Die EU soll bis 2050 klimaneutral werden. Diese ambitionierte politische Ansage wurde mit der Verabschiedung des EU Green Deals verpflichtend und betrifft damit auch die Wirtschaft und Industrie der einzelnen Mitgliedstaaten. Europäische Unternehmen müssen nun rasch Mittel und Wege finden, ihre CO2-Emissionen in den nächsten Jahren sukzessive zu reduzieren.
Und als wäre das nicht Herkulesaufgabe genug, ist eine der wichtigsten Vorgaben noch nicht einmal definiert: Was ist überhaupt der CO2-Fußabdruck und wie berechnet man ihn? Welche Herausforderungen muss ein Unternehmen meistern und welche Schritte gehen, um die Weichen erfolgreich Richtung Nachhaltigkeit zu stellen? Einige hilfreiche Denkanstöße und Erfahrungswerte möchte ich in diesem Beitrag mit Ihnen teilen.
Was ist der CO2-Footprint?
Der CO2-Footprint bezeichnet das Ergebnis einer Emissionsberechnung, bzw. einer CO2-Bilanz. CO2-Footprints kann man für ein ganzes Unternehmen, für Teilbereiche, für Produkte oder auch für einzelne Projekte bzw. Investitionen berechnen. Der CO2-Footprint bildet jene Menge an Treibhausgasen ab, welche durch eine Aktivität oder einen Prozess freigesetzt werden. Bei der Ermittlung des CO2-Footprints eines Unternehmens kommt es grundsätzlich darauf an, wann und wo die Emissionen anfallen, z.B.:
- direkt im Produktionsbereich (Unternehmen)
- durch den Einkauf der benötigten Energie, Produkte und Dienstleistungen
- im Rahmen der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette (Transport, Logistik), bei Anlieferung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie beim Transport zum Kunden
- Dienstreisen, Hotelübernachtung, Veranstaltungen etc., oder
- bei der Verwendung bzw. Verwertung und Entsorgung der hergestellten Güter (Kunde)
Warum messen Unternehmen ihren CO2-Footprint?
Für Unternehmen ist der CO2-Footprint das wichtigste Bewertungsinstrument zur Bewertung ihrer Treibhausgasemissionen. Er fließt in die Ökobilanz ein, wird in Nachhaltigkeitsberichten angegeben und bei der Kostenplanung berücksichtigt. Der CO2-Fußabdruck macht sichtbar, in welchen Bereichen Emissionen freigesetzt werden, wo sich Hot Spots in der Fertigungskette befinden und wo Potenzial für Verbesserungen und Einsparungen vorhanden ist. Darüber hinaus bildet er die Grundlage für die Formulierung betrieblicher Klimaziele (z.B. Science Based Targets).
Auch für Stakeholder eines Unternehmens gewinnen Informationen zum CO2-Footprint zunehmend an Bedeutung:
- Investorensehen enorme Wachstums- und Ertragspotenziale in der Förderung nachhaltig agierender Unternehmen.
- Bankenberücksichtigen nach Maßgabe der europäischen Bankenaufsicht sowie geltender EBA-Richtlinien die ESG-Kriterien (Environmental Social Governance). Die Zinsen für einen Kredit bemessen sich unter anderem danach, ob die ESG-Kriterien erfüllt werden bzw. entscheiden diese auch darüber, ob eine Kreditfreigabe überhaupt erfolgt.
- Kundenfragen immer öfter nach sauberen Produkten und Dienstleistungen und berücksichtigen diesen Aspekt bei ihren Kaufentscheidungen.
- Einkäuferprüfen zur Optimierung ihres eigenen CO2-Fußabdrucks die Klimaschutz-Standards bei Produzenten und Zulieferbetrieben.
- Junge Talentemachen ökologische Bemühungen und grüne Initiativen eines Unternehmens immer mehr zum Entscheidungskriterium für die Wahl ihres zukünftigen Arbeitgebers.
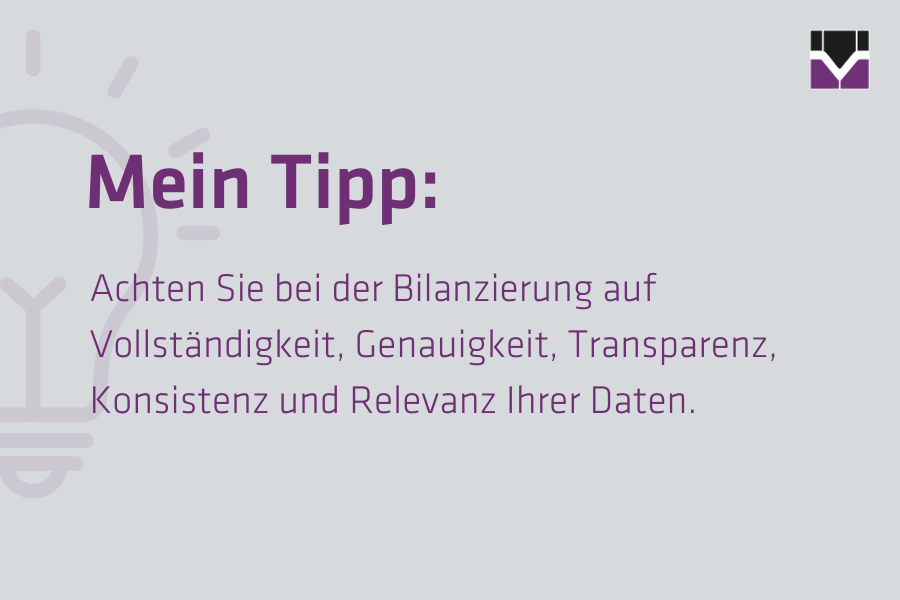
Wie wird der CO2-Footprint berechnet?
Die wichtigsten internationalen Standards zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks sind das Greenhouse Gas Protocol sowie die ISO-Norm 14064. Diese ordnen Treibhausgasemissionen von Unternehmen aber auch für den öffentlichen Bereich folgenden drei Bereichen zu:
- Scope 1:Direkt erzeugte Emissionen aus Brennstoffen im Betrieb bzw. durch Transportaktivitäten sowie flüchtige Emissionen (z.B. unbeabsichtigte Lecks).
- Scope 2: Emissionen durch zugekaufte Energie, wie Strom, Dampf, Wärme oder Kälte.
- Scope 3:Alle anderen indirekten Emissionen, die ein Unternehmen im Rahmen seiner Wertschöpfungskette freisetzt.
In 4 Schritten zur aussagekräftigen Treibhausgasbilanz
Für die Ermittlung einer aussagekräftigen Treibhausgasbilanz empfehlen sich folgende 4 Schritte:
Schritt 1: Definieren Sie Ziele und Grenzen: Definieren Sie die Grenzen Ihres Unternehmens und entscheiden Sie, für welche Scopes der Fußabdruck erstellt wird.
Schritt 2: Erheben Sie Aktivitätsdaten: Ermitteln Sie, welche Ihrer Aktivitäten und Prozesse CO2-Emissionen verursachen und zu welchen Scopes diese gehören.
Schritt 3: Bestimmen Sie CO2-Emissionsfaktoren: Definieren Sie die zu einer Aktivität oder einem Prozess zugehörigen Emissionsfaktoren und bestimmen Sie auf diese Weise, wie CO2-intensiv diese ausfallen.
Schritt 4: Erstellen Sie Ihre Treibhausgasbilanz: Auf Basis der vorangegangenen Schritte können Sie die Emissionen Ihres Unternehmens zu einer aussagekräftigen Treibhausgasbilanz konsolidieren.

Herausforderungen bei der Berechnung des CO2-Fußabdrucks
Jedes Unternehmen ist anders. Dennoch müssen bei der Berechnung des CO2-Fußabdrucks fast überall dieselben Hürden genommen werden. Folgenden Herausforderungen muss sich jede Organisation früher oder später stellen, wenn es den Weg zu mehr Klimatransparenz und Nachhaltigkeit einschlägt:
- Unterschiedliche Auslegung von Standards
Werden Emissionen dem Produkt zugerechnet oder dem Unternehmen? Und wo zieht man den Trennstrich? Diese Problematik stellt sich speziell bei Treibhausgasemissionen, die nicht direkt durch die Herstellung eines Produkts entstehen, wie beispielsweise Dienstreisen.Es gibt viele Ansätze und Herangehensweisen zur Ermittlung des CO2-Fußabdrucks, jedoch ist die Umsetzung von Standards wie dem GHG Protocolbis zu einem gewissen Grad Auslegungssache. Manche Unternehmen beschäftigen sich nur mit den Scope 1 und 2 Emissionen, andere betrachten auch Scope 3, davon manchmal aber nur ein paar Kategorien. Unternehmensübergreifend vergleichbare Ergebnisse bleiben dadurch meist eine Wunschvorstellung.
- Mangelnde Datenbasis und -qualität
Beim Heranziehen von Standards können die Berechnungsmethode und auch die zugrunde liegenden Faktoren zu Problemen führen. Denn obwohl es für Unternehmen schon sehr viele Tools zur einfacheren Berechnung ihres CO2-Fußabdrucks gibt (z.B. von ConClimate, CarbonCareoder KlimAktiv), stellt sich immer die Frage nach der Quelle und Qualität der dafür herangezogenen Daten.Davon sollte man sich nicht abschrecken lassen, denn in der Regel können Unternehmen auf sehr viele Primärdaten zugreifen. Falls nicht, sollte man einfach mit Schätzwerten und groben Berechnungen starten. Auf diese Weise schafft man eine erste Datenbasis, auf der man weiter aufbauen und später solidere Ergebnisse erzielen kann. Ein Start mit Schätzwerten und eine Priorisierung nach Ausgaben, z.B. über eingekaufte Waren, bietet den Vorteil, dass man die Relevanz bestimmter Faktoren einzuschätzen lernt und Gewichtungen vornehmen kann. Ist ein Emissionsfaktor im Vergleich zu anderen sehr klein, dann reichen hier auch in Zukunft grobe Annahmen aus.
- Finden des passenden Emissionsfaktors
Aufgrund der verschiedenen Informationen und Werte ist es gerade für Laien äußerst schwierig, den passenden Emissionsfaktor, beispielsweise für ein Abfallprodukt oder einen bestimmten Rohstoff, zu finden. Unabhängig von der Materialgüte kann bei der vorgelagerten Wertschöpfungskette von Stahl oder bei Treibstoffen sehr schwer nachvollzogen werden, was alles in die Berechnung miteinfließen muss.Man kann versuchen reale Daten der Lieferanten zu erheben (Primärdaten). Wenn diese nicht verfügbar sind sollte man diese mit Werten aus bestehenden Datenbanken für Sekundärdaten, wie z.B. ecoinvent, GaBioder Umweltbundesamt, abgleichen und darauf aufbauend lokale Emissionsfaktoren berechnen. Wenn die Datenbanken keine brauchbaren Daten liefern, sind Veröffentlichungen von Instituten bzw. Ministerien oder wissenschaftliche Publikationen die nächste Alternative. Kommt man auch auf diese Weise zu keinen zufriedenstellenden Ergebnissen, empfiehlt sich auch hier wieder die Arbeit mit Schätzwerten.
- Mangelnde Vergleichbarkeit
Obwohl einige CO2-Standards verfügbar sind, ist es wenig praxistauglich, den Emissionswert von Stahl mit jenem einer Kaffeemaschine zu vergleichen, um aussagekräftige Benchmarks zu ermitteln. Hier stellt sich die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, sich vergleichbar machen zu wollen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand liefert nur ein Vergleich innerhalb derselben Branche brauchbare Ergebnisse, wobei jede Datenbank auf anderen Berechnungsfaktoren beruht und diese relativ selten übereinstimmen.
Maßnahmen bei Welser Profile zur Ermittlung des CO2-Footprints
Wir haben gesehen: die Ermittlung des CO2-Footprints ist aus verschiedenen Gründen nicht immer einfach und stellt Unternehmen mitunter vor große Herausforderungen. Wie gehen wir bei Welser Profile mit der Tatsache um, dass wir unseren größten Emissionsfaktor, den zugekauften Stahl, bestens kennen, er zugleich aber unser täglich Brot ist? Ein nachhaltiger Umgang mit dem Material Stahl ist bei uns keine Zukunftsmusik, sondern Alltag und wir müssen uns stetig in unserer Zielerreichung verbessern.
Bei Welser Profile setzen wir zur Ermittlung unseres CO2-Footprints auf diese 4 Maßnahmen:
- Einführung eines Umwelt- und Energiemanagementsystems
Wir haben ein Umwelt– und Energiemanagementsystem implementiert, in dem alle für die Ermittlung der betrieblichen CO2-Emissionen relevanten Informationen zusammenlaufen. Dies umfasst unter anderem Daten zu Verpackungen, Werkzeugstählen, Abfällen sowie Werks-, Hilfs- und Betriebsstoffen. - Aufbau von Wissen
Basierend auf dem Geschäftsjahr 2019 haben wir über die letzten Monate mit sehr viel Aufwand und nach dem Learning by Doing-Prinzip eine interne Wissensdatenbank aufgebaut. Anhand dieser Grundlage konnten wir nun fundiertere Berechnungen vornehmen und unseren CO2-Footprint ermitteln. In Folge werden wir uns nun jene Bereiche ansehen, für die man Ziele zur Reduktion der Emissionen definieren kann und entsprechende Maßnahmen planen. Zur besseren Ermittlung der unternehmensbezogenen CO2-Emissionen ist darüber hinaus ein jährlicher Bericht geplant, der alle dafür relevanten Informationen zentral und nachvollziehbar zusammenfassen wird. - Einbindung von externem Know-how
Gerade wenn man nach dem Learning by Doing-Prinzip neue Pfade beschreitet, ist ein regelmäßiger Blick von außen sehr wichtig. Bei Welser Profile lassen wir daher unsere Pläne und Maßnahmen von erfahrenen Experten gegenprüfen. So haben wir aktuell ein Kooperationsprojekt mit Ecoplus laufen, im Rahmen dessen uns Berater bei der Scope 3-Berechnung unterstützen sowie bei der Wahl des richtigen Emissionsfaktors.
Gemeinsam arbeiten wir an der Beantwortung jener Fragen, die ganz spezifisch die Anforderungen unserer Branche bzw. unseres Unternehmens betreffen. - Baukastenprinzip für produktbezogenen CO2-Fußabdruck
Für die Ermittlung des produktbezogenen CO2-Fußabdrucks entsteht derzeit ein Prozess, der im Laufe des Jahres 2023 validierungsfähig sein wird. Seine Grundlage ist die Einführung eines Baukasten-Prinzips. Basierend auf Vorjahreswerten soll die Berechnung unter Berücksichtigung folgender variablen Größen durchgeführt werden:- Anlieferung des Vormaterials
- Profilproduktion mit dem zugeordneten Energieverbrauch
- verwendete Betriebsmittel
- Transport unserer Profile zum Kunden
Fazit: Kein aussagekräftiger CO2-Fußabdruck ohne Eigeninitiative
Das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit rückt immer schneller an die Spitze der betrieblichen Herausforderungen und wird dort, schon alleine wegen des Drucks durch den Gesetzgeber, nicht mehr verschwinden. Umso wichtiger ist es, dass Unternehmen jetzt selbst aktiv werden, sich eingehend mit der Thematik auseinandersetzen und notwendige Weichen für die Umsetzungsphase stellen. Learning by Doing ist dabei ein wichtiger Teil des Prozesses. Externe Berater können zwar wichtige Inputs liefern, ein interner Wissensaufbau ist jedoch für die Ausarbeitung neuer Standards sowie die Umsetzung diesbezüglicher Maßnahmen unerlässlich.
Mein Tipp:
Sorgen Sie in Ihrer Organisation rechtzeitig für die notwendigen personellen Ressourcen. Datenbanken alleine reichen für die Berechnung des CO2-Footprints nicht aus. Es braucht Fachkräfte, die die richtigen Daten finden, entsprechend zusammenführen und auswerten.
Fangen Sie einfach einmal an, probieren Sie verschiedene Zugänge aus und tasten Sie sich immer weiter voran. Denn das Einzige, was Sie wirklich falsch machen können, ist den Kopf in den Sand zu stecken und gar nichts zu tun. Alles andere ist schon ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.
Verfasserin: Ingrid Steindl, 31.1.2023
„Der freie Markt löst das Problem nicht“
Club-of-Rome-Mitglied Petra Künkel beim 5. Ressourcenforum in Salzburg:
„Der freie Markt löst das Problem nicht“
Anfang Mai fand in Salzburg das fünfte nationale Ressourcenforum statt wo sich Vertreter aus Industrie, Landwirtschaft und anderen Bereichen zum Thema Nachhaltigkeit austauschten: https://www.ressourcenforum.at/wp-content/uploads/2023/01/5NRF_23_Programm.pdf
Die Kunst des Erfindens
Video-Seminare mit Bruno Buchberger:
Die Kunst des Erfindens
Univ.-Prof. DDr. Bruno Buchberger hat den Club of Rome von Beginn an beraten und begleitet. Zuletzt war er Gast einem Rohrauer Gespräch, nach dem viele gemeint hatten, „mehr“ von ihm haben zu wollen. Daher wollen wir euch auf diese Möglichkeit hinweisen:
- 2 Tages-Seminare: „Die Kunst des Erfindens“ und „Die Kunst des Erklärens“
- vollständig als Videokurse gestaltet
- Entwickelt aus den jahrelang erfolgreich gestalteten Seminaren im Schloss Hagenberg
Seine Videokurse (mit erweitertem Inhalt) bietet Bruno Buchberger jetzt zum Einführungspreis von 49 Euro an.
„Beide Themen sind für kreative Manager, Forscher, Entwickler, Verkäufer, Teamleiter, Studenten, Politiker, … sehr wichtig. Mit dem Videoangebot kann man sehr viel Zeit und Geld sparen. Und ich kann aus Erfahrung berichten: Man kann den Erfolg drastisch steigern, wenn man hier grundlegende Techniken kennt. Meine Kurse kondensieren vor allem meine praktischen Erfahrungen über viele Jahre in Forschung und Management“, so Bruno Buchberger.
Zugang hier: thinking.brunobuchberger.com (selbsterklärender double opt-in Vorgang)
Dort kommt man für jeden Kurs zu einem kurzen Video, das den Nutzen des Kurses erklärt. Wenn einen dann der Kurs interessiert, kann man ihn per Klick kaufen. Die Kurse dauern jeweils ca. 4 Stunden und bestehen aus 10 bis 15 Lektionen. Man kann jederzeit unterbrechen und Teile beliebig oft anschauen bzw. benutzen.
Die Arbeit und ihre Rollenumkehr
Die Arbeit und ihre Rollenumkehr
Freizeit- und Arbeitsforscher Peter Zellmann erklärt, wieso der Begriff „Work-Life-Balance“ falsch verwendet wird, wie Polarisierung der Gesellschaft schadet und was Arbeitgeber zu lernen haben.
Die „Vier-Tage-Woche“ polarisiert. Work-Life-Balance polarisiert. Remote-Work polarisiert. Der Fachkräftemangel schockiert. Und polarisiert. Nicht nur die Welt ist im Wandel, sondern die Arbeit selbst durchläuft starke Veränderungen und sucht eine stabile neue Normalität.
Die Arbeit und ihre Rollenumkehr

Peter Zellmann ist Autor, Arbeits- und Freizeitforscher. In seinen Augen erleben wir aktuell grundlegende Veränderungen in vielen Bereichen.
„Die wichtigste Erkenntnis ist, dass sich die Rolle von Arbeitgeber und Arbeitnehmer umgedreht hat“, sagt er. „Heute müssen sich häufig Dienstgeber bei Mitarbeitern bewerben. Früher war das umgekehrt. Dies gilt vor allem im Dienstleistungsbereich, in Hotellerie und Gastronomie.“ (mehr …)